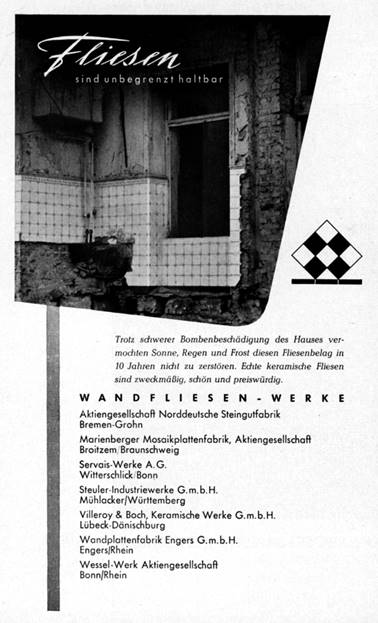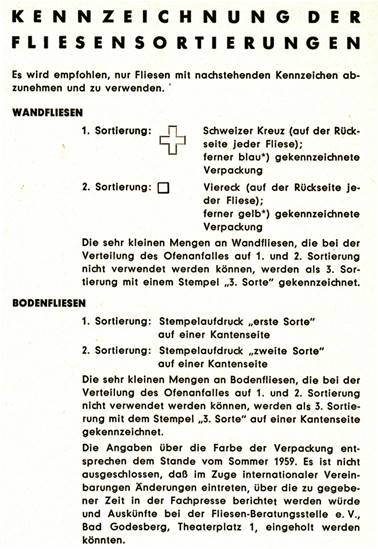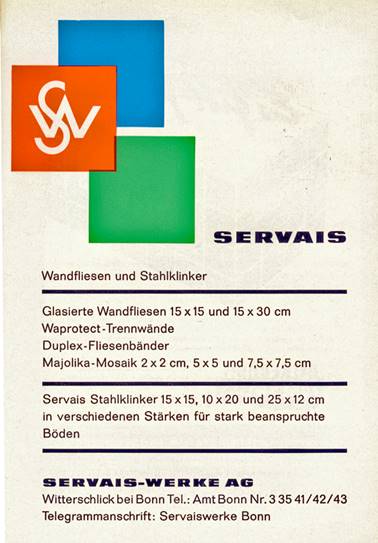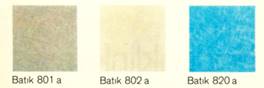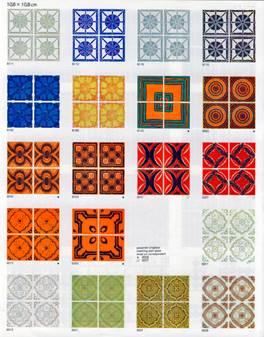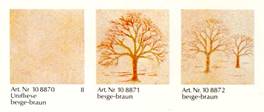Wilhelm Joliet
Die Geschichte der Fliese
|
GESCHICHTE DER
SERVAIS-WERKE WITTERSCHLICK
Witterschlick liegt in unmittelbarer Nähe der Stadt Bonn am
südlichen Ende des Vorgebirges im Nordrhein-Westfälischen Rhein-Siegkreis.
Seit Jahrhunderten wurde in der Gegend Ton abgebaut. In und um Witterschlick
entstanden Ziegeleien und Töpfereien. Man griff auf relativ nah unter der
Oberfläche liegende helle Tonschichten zurück.
Durch Zufall stießen die Brüder Johann und Joseph Braun im Jahre
1880 beim Bau eines Brunnens in Volmershoven, einem Ortsteil von
Witterschlick, auf blau-grau gefärbten Ton. Dieser war fester in der
Konsistenz als der Ton aus höher gelegenen Schichten. Sie ließen
Materialproben in der „Porzellan- und Steingutfabrik Ludwig Wessel“ in
Bonn-Poppelsdorf prüfen. Das Ergebnis: Es handelte sich um wertvollen
Blauton. Dieser zeichnet sich durch einen hohen Schmelzpunkt aus und ist zur
Herstellung feuerfester Produkte geeignet. Nach der Entdeckung wertvoller
Tonmineralvorkommen wurde Witterschlick industrialisiert.
Mit Philipp Lamberty und Bernhard Ferring hatte Paul Servais schon
1877 die Firma ‚Lamberty, Servais & Cie‘ zur Herstellung von Flurplatten,
Trottoirsteinen, Röhren und feuerfestem Material in Ehrang bei Trier
gegründet.
|
|
Paul Servais (14.07.1848 – 18.12.1908) Paul Servais heiratete 1883 Anne-Marie
Collart. Sie hatten 10 Kinder |
Am 3. Oktober 1889 wurde in Witterschlick bei Bonn das Unternehmen
‚Thonwerke Witterschlick, Servais & Co‘ gegründet.
Inhaber des Unternehmens waren:
1.
Paul Servais, Kaufmann aus Ehrang
2.
Ernst Servais, Kaufmann aus Kürenz bei Trier
3.
Peter Ludwig, Kaufmann aus Lützel bei Koblenz
4.
Hubert Capitain, Kaufmann aus Vallendar bei Koblenz
5.
Xavier de Saint Hubert, Kaufmann aus Luxemburg
6.
Eduard Grach, Privatier aus Trier
7.
Julius Collart, Hüttenbesitzer aus Steinfort (Luxemburg);
Schwiegervater von Paul Servais, eingetreten 1890
8.
Alphons Majerus, Notar in Mondorf-les-Bains, Luxemburg, Schwager von
Paul Servais, eingetreten 1891
Der Standort war wegen der nahen Ton- und Quarzvorkommen aber auch
wegen der Nähe zu rheinischen Großstädten gut gewählt.
Gebäude und Industrieanlagen wurden unter Direktor Konrad Schimm 1890
fertiggestellt. Seit dieser Zeit dominieren die Servais-Werke den Ort.
Nach Direktor Konrad Schimm 1888-1895, folgten die Direktoren Fritz
Grasse 1895-1896, Emil Stege 1896-1898 und Max Georg Villaret 1898-1915.
Die Werke in Ehrang und Witterschlick fusionierten am 23. Juli 1902
zur Aktiengesellschaft ‚Vereinigte Servais-Werke Ehrang-Witterschlick‘. Es
wurden Verblendsteine, unglasierte und glasierte Terrakotten und feuerfeste
Steine produziert. Vorstandsmitglieder waren Paul Servais und Xaver de Saint
Hubert. In eigenen Gruben baute man im Gebiet von Witterschlick Ton für die
eigene Produktion aber auch zum Vertrieb ab.
Ein Feuer zerstörte 1904 das Werk in Witterschlick vollständig. Es
wurde bis 1905 wieder aufgebaut und durch einen Produktionszweig zur
Herstellung von glasierten Wandplatten erweitert.
Auf der Weltausstellung Brüssel errang das ‚Thonwerk Witterschlick
Servais & Cie‘ 1912 einen Ehrenpreis.

In den Jahren 1910-1912 wurden einige Bereiche wegen gestiegener
Nachfrage modernisiert und erweitert. Mit Ausbruch des 1. Weltkrieges
veränderte sich die Produktion. Es stieg die Nachfrage nach feuerfesten
Produkten für die Rüstungsindustrie. Die Kapazität wurde 1915 durch den Kauf
einer weiteren Tongrube und die Fertigung feuerfester Produkte in einem
Zweigwerk in Hangelar erweitert. Direktor war (?) Görtz von 1915-1930.
Ab 1918, dem Ende des 1. Weltkrieges sank die Nachfrage nach
feuerfesten Schamotteprodukten. Im Werk Witterschlick wandte man sich
deshalb wieder der Plattenproduktion zu (Anmerkung: Damals wurde die heutige
Fliese noch als Platte bezeichnet). Den Schwerpunkt legte man auf die
Herstellung glasierter Wandfliesen. Nachgefragt waren vor allem uni weiße
und elfenbeinfarbene Fliesen. Majolikafliesen, mit durchscheinender
Bleiglasur, vergrößerten ihren Marktanteil.
Die Werke in Ehrang bei Trier schieden 1921 aus dem Verband mit
Witterschlick aus und gingen in die ‚Vereinigte Mosaik- und Wandplatten AG
Friedland-Sinzig‘ über. Witterschlick war Sitz der verbliebenen ‚Servais
AG‘.
Das Werk in Hangelar nahm 1927 die Herstellung von Fußbodenklinker
auf. Diese ‚Servais-Stahlklinker‘ wurden im Laufe der Zeit zum weltbekannten
keramischen Produkt.
Franz Servais war von 1930 bis 1942 Direktor der Servais AG.
|
|
Philippe Servais (1894 – 1967) Um 1934 begann Philippe Servais seine Tätigkeit bei den
Vereinigten Servais-Werken AG in Witterschlick. Er war verheiratet mit Lucy geb. Würth. Das Ehepaar wohnte
in einer Villa in Witterschlick in der Duisdorfer Straße mit ihren
Kindern Paul, Carlo und Luise. Foto aus Trenkle, Klaus, Bilder von Witterschlick – 1050
Jahre Ortsgeschichte, |
Mitglieder der Familie Servais verkauften 1939 66% ihres Anteils an
der Servais AG an die Wesselwerk GmbH in Bonn.
Für die Zeit bis 1945 fehlen Daten und Fakten der Servais-Werke, da
das Werk in Witterschlick gegen Ende des 2. Weltkrieges bei einem
Bombenangriff fast völlig zerstört wurde. Bekannt ist, dass Franz Lechner
von 1942 bis 1944 Direktor des Werkes war und Willy Haas die Direktion 1944
übernahm. Englische Besatzungssoldaten nahmen Quartier im vom Bombenangriff
weitgehend verschonten Verwaltungsgebäude.
Im Jahr 1946 begann in neu erbauten Werkshallen die Produktion von
Dachziegeln, einem keramischen Material, das zur Beseitigung von
Kriegsschäden und ersten Neubauten dringend benötigt wurde. Ein weiterer
wichtiger Zweig war die Fertigung von Isolatoren und anderen
Isolationselementen aus Elektroporzellan.
Bis zur Gründung der Bundesrepublik und der DDR 1949 war
Deutschland in Besatzungszonen aufgeteilt. Diese behinderten wirtschaftliche
Aktivitäten.
Der Aufbau der Wandfliesenproduktion in Witterschlick begann 1949. Der
Wiederaufbau des Werkes war 1950 abgeschlossen und der Start zum bedeutenden
keramischen Großunternehmen erfolgt.
In der Zeit des Wiederaufbaus wurden Baunormen (DIN-Normen)
verfasst, um Erfahrungen und Erkenntnisse unter Mitarbeit von einschlägigen
Erzeugerkreisen, der Bauaufsicht, der Materialprüfung und der interessierten
Abnehmerseite zusammenzufassen. In diesen ‚Normvorschriften‘ wurde - und
wird - der jeweils höchste technische Stand festgehalten.
Die Fliese im deutschen Normenwerk (Stand 1952)
Normen der keramischen Fliese
DIN 18155 Keramische Wand- und Bodenfliesen
DIN 12912 Fliesen für Labortische
DIN 18352 Fliesen- und Plattenarbeiten; ATV – Teil C/VOB
Normen der Prüfverfahren
DIN 1065 Prüfverfahren für
feuerfeste Baustoffe; spezifisches Gewicht, Raumgewicht,
Wasseraufnahmevermögen, Porosität
DIN 51090 Prüfung keramischer Roh- und
Werkstoffe; Biegeversuch an Bauteilen für Wand- und Bodenbeläge
DIN 51091 Bestimmung der Säure- und
Laugenbeständigkeit von unglasierten Fliesen und Platten für Wand- und
Bodenbeläge
DIN 51092 Bestimmung der Säure- und
Laugenbeständigkeit von glasierten Fliesen und Platten für Wand- und
Bodenbeläge
DIN 51093 Bestimmung der
Temperaturwechselbeständigkeit von Fliesen und Platten für Wand- und
Bodenbeläge
DIN 51094
Bestimmung der Lichtechtheit der Färbung von Fliesen und Platten für Wand-
und Bodenbeläge
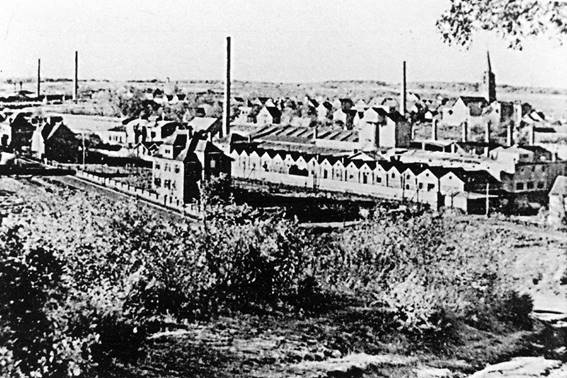
1952 – Blick vom
Hardtberg auf Witterschlick und die Servais-Werke AG
Bild aus der Sammlung Karl-Heinz Krein,
Witterschlick: veröffentlicht in Trenkle, Klaus, Bilder von Witterschlick –
1050 Jahre Ortsgeschichte, Beiträge zur Geschichte von Witterschlick, Heft
Nr. 20, Witterschlick 2015.
|
|
1954 veröffentlichten die deutschen Wandfliesen-Werke im
Fliesen-Taschenbuch diese Anzeige. |
Der Fachverband der Keramischen Wand- und Bodenfliesen-Industrie schaltete
im Fliesen-Taschenbuch 1954 die folgende Reklame:
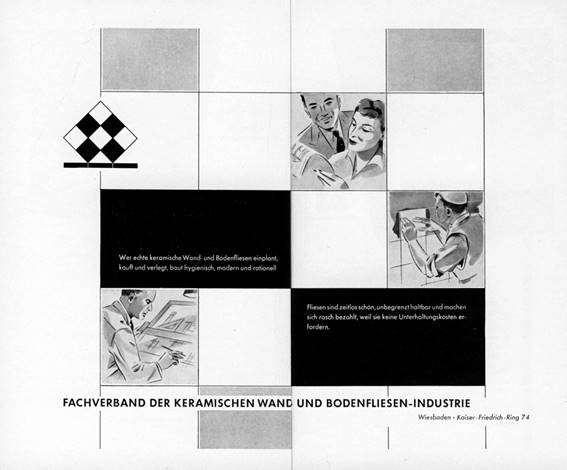
Geschäftsführer des Fachverbandes der Keramischen Wand- und
Bodenfliesen-Industrie war Dr. rer. pol. Erich Hückstädt.
Die Zeit des Wiederaufbaus und Wirtschaftswunders nahm ihren Anfang.
Keramische Fliesen begannen einen Siegeszug. In
15 Werken Westdeutschlands sind im Jahre 1953 fast 7,5 Millionen
Quadratmeter Wandfliesen
und etwa 4,5 Millionen Quadratmeter Bodenfliesen hergestellt worden.
Gegenüber 1949 bedeutete dies bei Wandfliesen eine Verdoppelung der
Produktion. Bei Bodenfliesen betrug die Steigerung gegenüber 1949 fast das
2,5fache. Hierbei ist zu beachten, daß sich die Gesamtzahlen ausschließlich
auf die feinkeramischen Erzeugnisse Wand- und Bodenfliesen bezogen und nicht
etwa grobkeramische Produkte wie Klinkerplatten, Spaltverblender u. a.
einschlossen.
Voraussetzungen für
diese Fortschritte waren tiefgreifende Rationalisierungen in den Betrieben,
angefangen von Verbesserungen technischer Einzelvorgänge bis zu
grundsätzlichen Umstellungen im Brennprozeß, wobei der allgemeine Übergang
zum Tunnelofen besonders hervorzuheben ist.
Es gab gute Kontakte zwischen der Fliesen produzierenden Industrie und dem
Fliesen verarbeitenden Gewerbe.
Das Fliesen- und Plattenverlegegewerbe nahm innerhalb der Bauberufe sowohl
hinsichtlich der Zahl der Betriebe, wie auch des Umfanges seiner Leistung
einen besonderen Platz ein.
Den Vorsitz der Bundesfachgruppe im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
e.V. führte
Fliesenlegermeister August Kurlbaum, Bonn. Über die ihm angeschlossenen 16
Landesfachgruppen betreute die Bundesorganisation rund 1700 Fliesen- und
Plattenverlegebetriebe mit über 15000 Beschäftigten. Die Zahl der Lehrlinge
erreichte 1750. Der Bundesfachgruppe Fliesen- und Plattenverlegegewerbe
gehörten weitaus alle Fachgeschäfte und Verlegebetriebe des Fliesengewerbes
im Bundesgebiet an, die ihrer Struktur nach neben dem Fliesenhandel in der
Hauptsache Fliesen- und Plattenverlegearbeiten ausführten.
Die Servais-Werke, mit ihrem langjährigen Direktor Willy Haas, lieferten
Fliesen vor allem ins Rheinland, ins Ruhrgebiet und in die Gegend um
Frankfurt. Voraussetzungen für die Aufwärtsentwicklung der Witterschlicker
Servais-Werke in nie geahnter Größe waren geschaffen. Die Produktion
hatte sich im Jahre 1955 gegenüber den Jahren vor dem 2. Weltkrieg
vervielfacht und die Belegschaft sich auf rund 600 Mitarbeiter verdoppelt.
In Witterschlick wurden ab 1954 flammglasierte Servais-Stahlklinker
hergestellt. Im Fabrikationsprogramm waren Stahlklinker im Format 20/10/1,5
cm in sieben verschiedenen Farben, Treppenklinker mit und ohne Profil im
Format 30/10/2,5 cm und Klinker mit Ablaufnase für Fensterabdeckungen im
Format 25/12/2,5 cm.
Dazu waren laut Sonderprospekt weiterhin lieferbar Servais-Stahlklinker
rotbraun und rotbunt als Sechseck, Spitzklinker, Klinker mit trittsicheren
Nocken, Klinker mit Netzprofil, Klinkerriemchen, Treppenklinker mit und ohne
Profil, Klinker mit Ablaufnase für Fensterabdeckungen sowie Hohlkehlsockel
mit und ohne Fase.

Der Bauboom ließ die Preise für Baumaterial unaufhörlich steigen. Um den
Preisanstieg einzudämmen, wurden entsprechende Einfuhrzölle abgeschafft.
Durch importierte Waren wurde das Angebot erhöht und Preise gesenkt.
Betroffen waren auch die deutschen Fliesenhersteller. Italienische
Fliesenwerke verdoppelten ihre Exporte nach Deutschland innerhalb von zwei
Jahren, mit dem Ergebnis, dass die Marktpreise rapide sanken.
|
|
Ein gut installiertes kleines Fliesenbad. Die Fensterbank ist mit
Fliesen bekleidet. Zehn Fliesen betrug damals die übliche Höhe der
Fliesenbekleidung. Über der Reihe aus Abdeckfliesen fand man häufig
einen sogenannten ‚Wischstreifen‘. Üblich war die Einarbeitung eines
Revisionsrahmens in die Wannenblende in Höhe des Wannenablaufs.
Bild aus dem Fliesen-Taschenbuch, fünfte Ausgabe, Wiesbaden 1959. |
|
|
Veröffentlichung im Fliesen-Taschenbuch, fünfte Auflage, Wiesbaden
1959. |
Im Aufschwung der Nachkriegszeit erlebte das Heimwerken den großen Boom.
Unter dem Motto ‚Selbst ist der Mann’ erschien am 1. November 1957 das erste
Heimwerkermagazin.
Der erste Baumarkt eröffnete im April 1960 in Mannheim. Begünstigt wurde das
Heimwerken mit Fliesen durch das Dünnbettverfahren.
Am 09.10.1959 starb der allseits beliebte Willy Haas, Direktor in
Witterschlick seit 1944.
|
|
Anzeige der Servais-Werke AG
im Fliesen-Taschenbuch, sechste Auflage, Wiesbaden 1961. |
Die deutschen Hersteller, darunter auch die Servais-Werke Witterschlick,
verkauften nur über den Fliesenhandel und überließen das Geschäft mit den
Baumärkten der ausländischen Konkurrenz. Zudem
war die ausländische Konkurrenz mittlerweile aufgrund modernerer
Fertigungsmethoden in der Lage, deutlich günstiger zu produzieren als die
inländischen Hersteller. Die goldenen Zeiten der deutschen Fliese waren
vorbei. Mancher Hersteller keramischer Produkte blieb auf der Strecke,
Standorte wurden aufgegeben und mit Fusionen versuchten sich Werke zu
sanieren.
Direktor Philipp Servais war bis zum 01.01.1964 im Vorstand der
Servais-Werke AG.
Peter Weber und Rudolf Mezger wurden 1964 in den Vorstand berufen.
Die Servais Werke AG in Witterschlick behauptete sich am Markt. Ein
Wandfliesen-Fabrikations-Programm vom Februar 1965 zeugt von deren
Leistungsfähigkeit. Es wurden Wandfliesen im Normalformat 15x15 cm,
Refo-Spezialformat 10,8x21,8 cm und Großformat 15x30 cm angeboten.
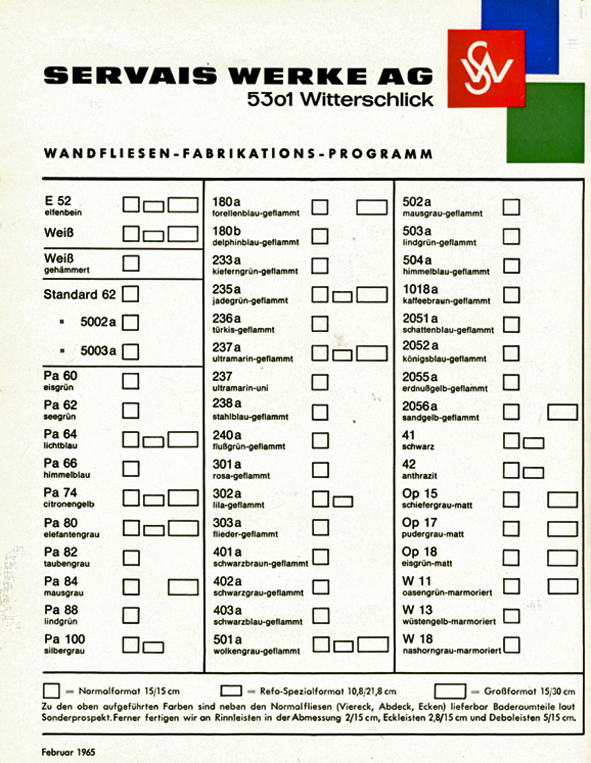
Die Färbung keramischer Glasuren wurde in der Regel durch geringe Beimengungen von Metallverbindungen erzeugt. Ab den 70 er Jahren wurde in der Wandfliesen-Produktion die Färbung der Glasuren jedoch ausschließlich durch die Zugabe von Farbkörpern erzielt. Das sind stabile unlösliche anorganische Farbpulver, die aus der Verbindung verschiedener Metallverbindungen mit anderen Rohstoffen wie Tonerde, Quarz oder Zink bei sehr hohen Temperaturen gebrannt, anschließend feingemahlen und den Glasuren zugegeben werden. So ergeben Mischungen aus Kobalt, Tonerde und Zink hellblaue bis tiefblaue, Mischungen aus Eisen, Kalk, und Zink rosa bis eisenrote und Mischungen aus Zinn und Chrom lila Farbpigmente.
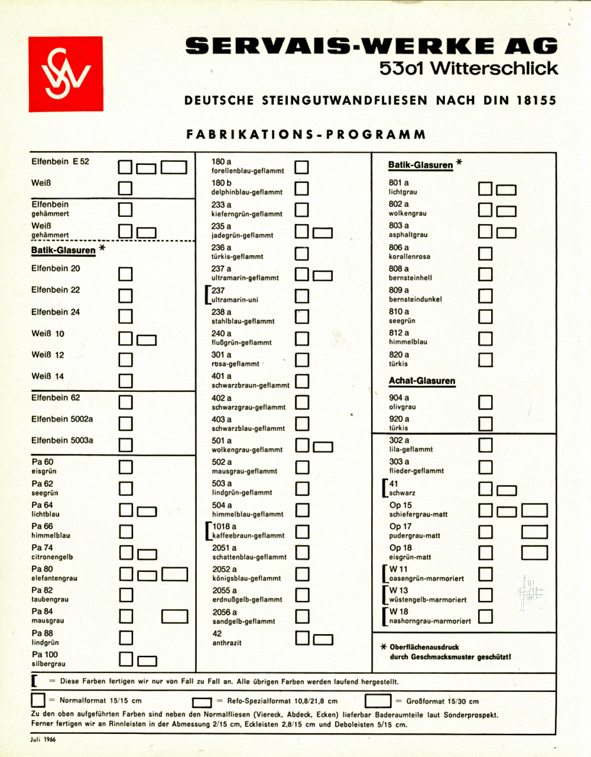
Zu den aufgeführten Farben waren neben den Normalfliesen (Viereck, Abdeck,
Ecken) Baderaumteile lieferbar.
Ferner wurden Rinnleisten in der Abmessung 2x15 cm, Eckleisten 2,8x15 cm und
Deboleisten 5x15 cm angeboten.
|
|
Das Fabrikationsprogramm vom Juli 1966 enthielt u.a. Batik-Glasuren,
|
1967 starb Konsul Wilhelm Wessel. Dr. A.M. Kugelmeier übernahm den Vorsitz
des Aufsichtsrates. Hauptaktionär wurde der mit der Tochter von Konsul
Wilhelm Wessel verheiratete Dr. Nikolaus Fasolt.
Die Servais-Werke AG in Witterschlick und die Wessel-Werk GmbH in Bonn
brachten parallel Achat-Fliesen auf den Markt. Beide Werke händigten
Fliesenhandel und Fliesenhandwerk u.a. Prospekte für Achat-Fliesen aus.
|
|
Titelseite vom Prospekt ‚Achat-Fliesen‘ der Servais-Werke AG aus dem
Jahr 1968. |
Zu den Steingutwandfliesen lieferte die Servais AG Baderaumteile in allen
Glasurfarben.






Noch in den 60er Jahren gab es nur in jedem dritten Haushalt ein Badezimmer.
Die üblichen Farben der Wandfliesen in diesen Bädern waren Blau, Grün und
Rosa und das Format der Fliesen 15x15 cm. Fliesen wurden verarbeitet, weil
sie als zweckmäßig, hygienisch, zeitlos schön und unbegrenzt haltbar galten.
In den 70er Jahren wurde das eigene Badezimmer zur Normalität. Bauherren
machten von der Vielfalt angebotener Glasurfarben Gebrauch. Neben
Zweckmäßigkeit und Hygiene trat nun die Optik in den Vordergrund. Dazu
gehörte auch die teilweise Abkehr vom gängigen Format 15x15 cm der Fliesen
zum Format 10,8x10,8 cm, dem Refo-Format 10,8x21,8 und zum Großformat 15x30
cm. Dieser Trend half der deutschen keramischen Industrie aus einer
kurzfristigen Marktsättigung.

Servais-Werke AG um 1970
Bild aus der Sammlung Karl-Heinz Krein, Witterschlick
veröffentlicht in Trenkle, Klaus,
Bilder von Witterschlick – 1050 Jahre Ortsgeschichte, Beiträge zur
Geschichte von Witterschlick, Heft Nr. 20, Witterschlick 2015
1970 bestand der Vorstand der Servais AG aus Dr. Nikolaus Fasolt und den
Direktoren Rudolf Mezger und Peter Weber.
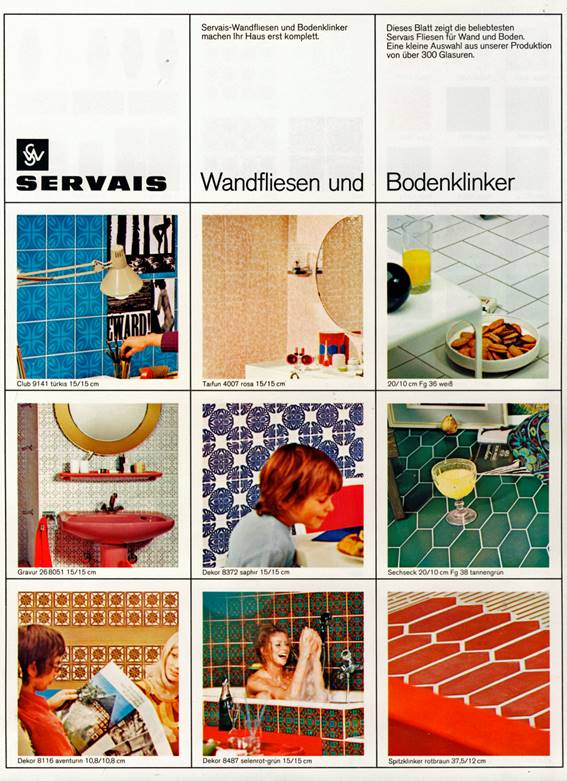
Prospekt Juni 1971, Seite 1
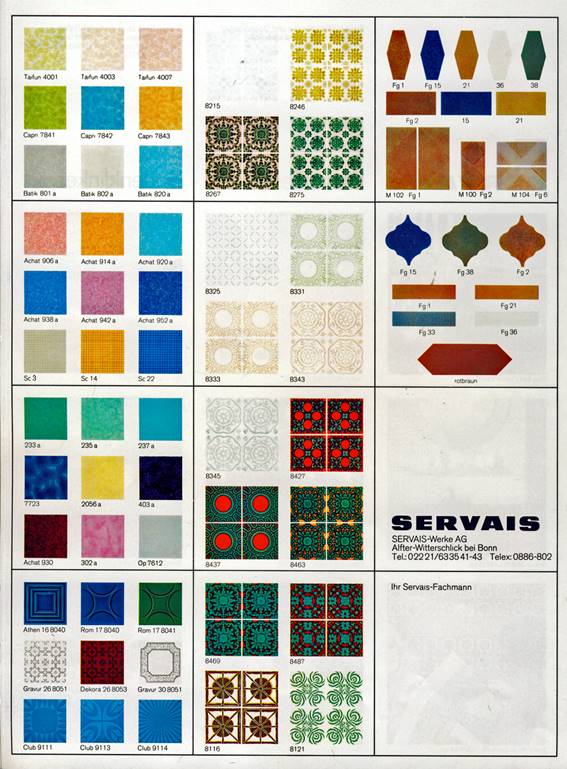
Prospekt Juni 1971, Seite 2
|
|
Seite aus dem Katalog ‚SERVAIS DEKOR-WANDFLIESEN‘ von 1972.
Format 108x108 mm.
Eine passende Uniglasur gab es für die Dekore 8143, 8883, 9233,
9243, 9273 und 9283 mit der Fliese 9203.
Die passende Uniglasur für die Dekore 9257 und 9267 war die Fliese
9207. |
Die Badezimmer der 70er Jahre wurden immer bunter. Nicht nur die farbigen
Glasuren der Fliesen, sondern vor allem die farbigen Sanitäreinrichtungen
prägten das Bild.
Sanitärfarben trugen die Bezeichnungen bahamabeige, balibraun, carneol,
indischelfenbein, kalaharigelb, kaschmirbeige, moosgrün und sorrentoblau.
Für Werbefotos stellten die KERAMAG AG und die Ideal Standard GmbH der
Servais-Werke AG ihre Sanitär-Keramik zur Verfügung.
|
|
PERGOLA 198x298x10 mm
Wand- und Bodenfliese, mit unterschiedlicher Schattierung in jeder
Fliese und Blumendekor bringen kräftige Bewegung in den Raum.
Haselnuß ist die Grundfarbe. Das Blumenmotiv aus den Fliesen 22
5606, 22 5607 und 22 5608 hat die Farben curry-oliv und
carneol-oliv. |
Von der Servais-Werke AG wurden Fliesenhandel und Verlegebetrieben neben
aussagekräftigem Prospektmaterial gegen Kostenerstattung Musterschränke in
verschiedenen Größen zur Verfügung gestellt. Beliebt waren halbhohe Schränke
mit vierzehn waagerechten Schiebetafeln. Die Tafeln hatten Griffe, welche
ein Aufhängen an der Wand ermöglichten. Es konnten auch zusätzliche
Aufstellkonsolen (siehe Abb.) geliefert werden.
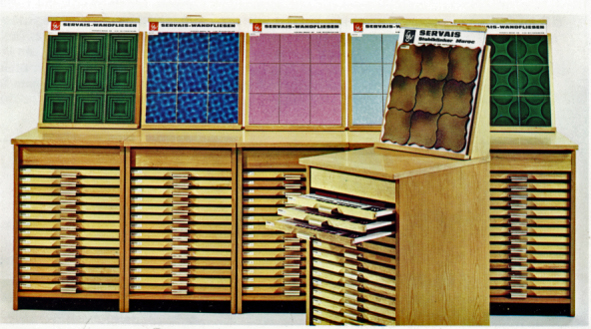
Die Servais-Werke AG fertigte in ihrem Werk I in Alfter-Witterschlick
Steingutfliesen nach DIN 18155 in den Formaten 15x15 cm, 10,8x10,8 cm und
9,8x19,8 cm, dazu Waprotect-Trennwände und Fliesen-Fix-Tafeln. Es war eine
große Produktpalette mit mehr als 300 verschiedenen Dessins, Strukturen,
Farben und Glasuren.
Im Werk II wurden Servais-Bodenklinker und im Werk III feuerfeste Tone und
Schamotte produziert.
Man versuchte, jede Nische auf dem keramischen Markt zu bedienen. 1976
stellte man 47 Millionen Quadratmeter Steingutfliesen her.
1977 wurde 75jähriges Bestehen der Servais AG gefeiert. Vorstand der
Servais-Werke AG war Dr. Nikolaus Fasolt, gleichzeitig Chef der
Wessel-Servais-Gruppe. Seine Stellvertreter waren Peter Weber
(kaufmännischer Direktor) und Artur Mocker (technischer Direktor). Es wurden
etwa 900 Personen in Fabrikation und Verwaltung beschäftigt.
Trotz aller Bemühungen sah man sich Mitte der 80er Jahre zu Fusionen
gezwungen.
Es kam zum Zusammenschluß der
 .
.
Die AGROB aus Ismaning, seit Anfang der 70er Jahre das modernste
Wandfliesenwerk Europas, kaufte die Anteile der Wessel-Werke in Bonn und der
Servais-Werke in Witterschlick. Ab 1984 firmierte dieser Verbund als AGROB
WESSEL SERVAIS AG.
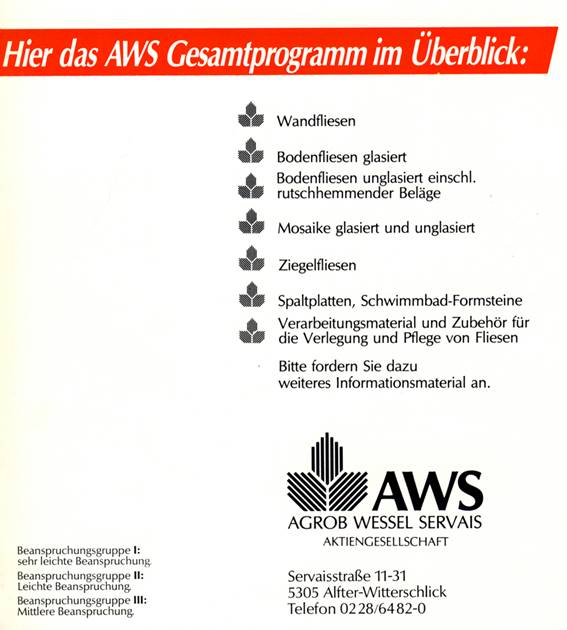
Die Fliesen der AWS wurden Anfang der 90er Jahre wieder heller. Farbige
Sanitär-Keramik verlor ihren Stellenwert in deutschen Bädern. Dafür wurden
Bordüren dominierende Elemente.
 Bordüre
Nr. 413
Bordüre
Nr. 413
|
Scan aus dem Prospekt
Wandfliesen 2 vom Juni 1984. |
Steingutfliese, Serie ‚Eifel‘, Format 198x198x10 mm.
Der Hinweis II bei der Unifliese besagte, dass diese Fliese bei
leichter Beanspruchung auch als Bodenbelag verwendbar war. |
1990 brachte die AWS die Serie ‚Capitol‘ auf den Markt. Durch eine neue
Technik (Nass in Nass - Auftrag der Glasur) erzielte man eine Marmoroptik.
Jede Fliese unterschied sich in der Struktur der Glasur von den anderen aus
gleicher Charge. Siebdruckbedingte Aneinanderreihung gleicher Motive wurde
damit überwunden. Jede Fliese war ein Unikat.
Auch die Entwicklung in der Drucktechnik vom Siebdruck über den Offsetdruck
bis hin zur digitalen Oberflächengestaltung veränderte die optische
Gestaltung der Wand- und Bodenfliese.
Mittlerweile drängten neben europäischer Konkurrenz auch Fliesenwerke aus
Fernost auf den deutschen Markt. Die AWS AG kämpfte trotz hervorragendem
Design und technischer Innovation vergeblich um erforderliche Marktanteile.
1992 fusionierte die AWS AG mit der
Deutschen Steinzeug Cremer und Breuer AG aus Frechen.

2009 beschäftigte der Konzern 1605 Personen, davon etwa 350 in Produktion
und Verwaltung in Alfter-Witterschlick.
Die Deutsche Steinzeug Cremer und Breuer AG entwickelte sich zu einem
weltweit führenden Hersteller im Bereich keramischer Fliesen.
Was wird im Jahr 2021 im Werk Witterschlick produziert?
„Im
Werk Witterschlick werden in 4 Rollenöfen ausschließlich Steingutfliesen
gefertigt. Die Formatpalette umfasst traditionelle Abmessungen wie 15x15,
15x30 und 20x20 genauso wie die Großformate 30x60, 30x90, 25x75 und 35x 100
cm, um nur die wichtigsten zu nennen. Seit dem Jahr 2020 fertigt das
Unternehmen an diesem Standort auch Steingutfliesen in den Formaten 30x60
und 30 x90 cm, die mit nur sechs Millimeter Stärke deutlich dünner und
leichter sind als herkömmliche Erzeugnisse dieser Produktgattung.“
|
|
FOCUS ROYAL
Dekorfliese Step 30x90 cm,
Herstellmaß 297x897x10,5 mm.
392740H champagner
392742H dunkelrot |
Scan aus dem Lieferprogramm Deutsche Steinzeug 2020, Living 10.22
Die Wandfliesen haben gerundete, geschliffene Kanten.
|
|
MODERN WHITE
Dekorfliese Botanic 30x60 cm,
Herstellmaß 297x597x9 mm
283113H
tropical garden
2er-Set
283114H
urban garden
2er-Set |
Scan aus dem Lieferprogramm Deutsche Steinzeug 2020, Living 10.52
„Ein großer Anteil der produzierten Fliesen wird mit einer
photokatalytischen Veredelung versehen,
die bereits im Werk
dauerhaft eingebrannt wird. Unter der Bezeichnung ‚Hytect‘
werden die mit dieser innovativen Lösung versehenen Produkte als ‚Hygienefliesen‘
beworben.“
|
Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Servaisstraße 9-11
D-53347 Alfter-Witterschlick
EMail:
info@deutsche-steinzeug.de |
|
|
Benutzte Literatur
Fliesen-Taschenbücher 1954, 1957, 1959 und 1961.
Trenkle, Klaus, Beiträge zur
Geschichte von Witterschlick, Heft Nr. 20, Witterschlick 2015
Blum, Hans-Joachim, Fliesen aus
Witterschlick, Witterschlick 2017
Deutsche Steinzeug Lieferprogramm 2020
Wikipedia
Danksagung
Meinen ehemaligen Meisterschülern Markus Austermann und Ralf Sädler danke
ich für ihre Zurverfügungstellung von historischem Prospektmaterial.
Herr Hans-Joachim Blum schickte mir seine Veröffentlichung als PDF und
erlaubte mir, daraus Daten und Fakten in meinen Bericht zu übernehmen.
Herrn Werner Ziegelmeier danke ich für mannigfaltige Hilfe.
Herr Dr. Klaus Trenkle genehmigte mir die Übernahme von einigen Daten und
Fakten, vor allem aber von Bildmaterial aus seiner Veröffentlichung
‚Beiträge zur Geschichte von Witterschlick‘.
Meinem Sohn Norbert danke ich für die Bearbeitung und Veröffentlichung des
Berichtes.